Archaeology and Palaeoecology of the Inner Congo Basin (Wotzka, Hans-Peter)
Mittel- bis spätholozäne Biotopgrenzen, Siedlungslimits und Verbindungskorridore

Michael Schmeling, licensed under CC BY 4.0 international, waterbodies © OpenStreetMap contributers, modification by Johanna Sigl
Projektbeschreibung
Das Projekt verfolgt vier wesentliche Ziele: (1) Nachverfolgung des Einwanderungsprozesses, der die frühe Eisenzeit im äquatorialen Regenwald des inneren Kongobeckens (Demokratische Republik Kongo) vor etwa 2400 Kalenderjahren einleitete. Ausgangspunkt ist die Hypothese, dass die mit diesem Prozess assoziierte Imbonga-Keramik aus der zentralen Region der westlich angrenzenden Republik Kongo stammt. Die Überprüfung dieser Hypothese durch archäologische Feldforschung entlang der großen Flüsse, die in der Ogowe-Kongo-Wasserscheide entspringen und in den Kongo entwässern, wird darauf abzielen, die großen Migrationen der frühen Eisenzeit anhand von Relikten der materiellen Kultur abzugrenzen. (2) Erstellung einer holozän-spätpleistozänen paläoökologischen Basissequenz für das innere Kongobecken. Der Abschluss der laufenden Pollen- und geochemischen Analysen an einer Reihe von Sedimentkernen aus dem Kongobecken-Torfkomplex zielt auf die Erstellung einer ersten regionalen Referenzsequenz ab. Auf diese Weise sollen die lokale Paläovegetation und das Hydroklima an den wichtigsten Stellen des Kongo-Flussbogens rekonstruiert werden. Dies wird es ermöglichen, die Kernzone des äquatorialen Regenwaldes in die Prüfung von Hypothesen einzubeziehen, die sich auf Folgendes beziehen: (a) spätpleistozäne und holozäne Regenwaldrefugien; (b) eine vermutete universelle Krise des zentralafrikanischen Regenwaldes vor etwa 2500 Jahren; und (c) gleichzeitige Verflechtungen zwischen Mensch und Landschaft.
(3) Sammlung von paläoökologischen Daten in der zentralen Republik Kongo. Durch den Erwerb von zwei neuen Sedimentkernen vom südwestlichen Rand des Kongobecken-Torflandkomplexes soll ein Ost-West-Transekt vom Inneren Kongobecken über den Kongo-Fluss geschaffen werden. Die Untersuchung dieses noch wenig erforschten Gebiets wird die paläoökologischen Arbeiten ergänzen, die derzeit weiter nördlich in der Republik Kongo durchgeführt werden. Eine der dringlichsten Forschungsfragen in diesem Gebiet, dessen nördlicher Teil in die als Sangha River Interval bekannte biogeographische Zone hineinreicht, betrifft das Alter der regionalen Savannen. Neben den fossilen Pollenfunden sollte die palynologische Arbeit in diesem Gebiet auch die Dokumentation des modernen Pollenregens in verschiedenen Vegetationszonen umfassen, um als Referenzdaten für die Interpretation der regionalen Vegetationsgeschichte und der historischen Ökologie zu dienen. (4) Rekonstruktion der Wirtschaft und der Ernährungsgewohnheiten der frühen Eisenzeit im Inneren Kongobecken und den westlich angrenzenden Gebieten. Ein vertieftes Verständnis der beginnenden Landwirtschaft und der menschlichen Ernährung wird angestrebt, um die klimatischen und umweltbedingten Einflüsse auf die wirtschaftlichen und kulturellen Entscheidungen der Menschen bewerten zu können. Zu diesem Zweck werden neue Ausgrabungen mit archäobotanischen, archäozoologischen und phytolithischen Probenahmen sowie die fortgesetzte Anwendung der Analyse organischer Rückstände an gut kontextualisierten Scherben durchgeführt. Insbesondere ist es von Interesse zu wissen, auf welche Arten von pflanzlicher und tierischer Nahrung die Menschen angewiesen waren und was sie in Keramikgefäßen zubereiteten. Eine wichtige Frage ist, ob bereits vor ~AD 1450, dem Zeitpunkt der bisher ältesten faunistischen Nachweise aus dem Inneren Kongobecken, Haustiere gehalten wurden.
Projektmitglieder

Antragssteller/Projektleiter
Universität zu Köln, Institut für Ur- und Frühgeschichte, Forschungsstelle Afrika

Palynologe
Universität zu Köln, Institut für Ur- und Frühgeschichte, Forschungsstelle Afrika

Studentische Mitarbeiterin
Universität zu Köln, Institut für Ur- und Frühgeschichte, Forschungsstelle Afrika
Posts

Bericht über die Jahrestagung der SPP Entangled Africa in Münster
Allgemein, P01 Praehistorische Beile, P02 Connecting Foodways, P03 InterLINK, P04 Tschadsee, P05 Landschaften, P06 DeGreening, P07 Routes of Interaction, P08 KlimZellMit, P09 Lehnwoerter, P10 Kongobecken, P11 FDM, P12 Koordination, P13 Tracing Connections![[Attribution: unknown; Copyright: not defined] D-DAI-KAAK-2024-JS-0063-PlanetAfrica_Eroeffnung_BER](https://www.dainst.blog/entangled-africa/wp-content/uploads/sites/11/2024/12/D-DAI-KAAK-2024-JS-0063-PlanetAfrica_Eroeffnung_BER-scaled-e1734001679313-247x163.jpg)
„Planet Africa“ in der James-Simon-Galerie: Ausstellungseröffnung und Pressestimmen
Allgemein, P01 Praehistorische Beile, P02 Connecting Foodways, P03 InterLINK, P04 Tschadsee, P05 Landschaften, P06 DeGreening, P07 Routes of Interaction, P08 KlimZellMit, P09 Lehnwoerter, P10 Kongobecken, P11 FDM, P12 Koordination, P13 Tracing Connections![[Attribution: ; Copyright: ] KAAK-SPP2143-TN-2023_Jahrestagung_Frankfurt_01-2022-8](https://www.dainst.blog/entangled-africa/wp-content/uploads/sites/11/2023/01/KAAK-SPP2143-TN-2023_Jahrestagung_Frankfurt_01-2022-8-247x163.jpg)
SPP-Jahrestagung an der Goethe-Universität Frankfurt vom 16. bis 17. Januar 2023
Allgemein, P01 Praehistorische Beile, P02 Connecting Foodways, P03 InterLINK, P04 Tschadsee, P05 Landschaften, P06 DeGreening, P07 Routes of Interaction, P08 KlimZellMit, P09 Lehnwoerter, P10 Kongobecken, P11 FDM, P12 Koordination, P13 Tracing Connections![[Attribution: J. Sigl; Copyright: Entangled Africa, KAAK] 2022-01-10_Teilnehmende07](https://www.dainst.blog/entangled-africa/wp-content/uploads/sites/11/2022/01/2022-01-10_Teilnehmende07-247x163.jpg)



![[Attribution: ; Copyright: ] csm_Main_Slider_PK_neu_07-10-21_ddd27b69dd](https://www.dainst.blog/entangled-africa/wp-content/uploads/sites/11/2021/10/csm_Main_Slider_PK_neu_07-10-21_ddd27b69dd-247x163.jpg)
![Daten & Folie: Mansour Mdawar, Projekt KlimZellMit [Attribution: J. Sigl; Copyright: KAAK] 2021-05-11_03](https://www.dainst.blog/entangled-africa/wp-content/uploads/sites/11/2021/06/2021-05-11_03-e1622808364550-247x163.jpg)

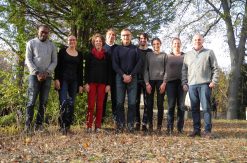


![[Attribution: Menges et al. 2025; Copyright: CC-BY-NC] Menges_etal_QarternaryScienceReviews_Fig1](https://www.dainst.blog/entangled-africa/wp-content/uploads/sites/11/2025/06/Menges_etal_QarternaryScienceReviews1-s2.0-S0277379125002653-gr1-247x163.jpg)
![[Attribution: unknown; Copyright: Springer-Verlag GmbH Germany, part of Springer Nature] Screenshot 2022-02-25 at 14-03-34 Vegetation History and Archaeobotany](https://www.dainst.blog/entangled-africa/wp-content/uploads/sites/11/2022/02/Screenshot-2022-02-25-at-14-03-34-Vegetation-History-and-Archaeobotany-247x163.png)
![[Attribution: ; Copyright: ] Wotzka et al ausschnitt](https://www.dainst.blog/entangled-africa/wp-content/uploads/sites/11/2021/03/Wotzka-et-al-ausschnitt-247x163.jpg)